Jahrzehntelange Fehlanreize treiben die Schweizer Landwirtschaft wirtschaftlich an den Abgrund
Wertschöpfung und Wirtschaftlichkeit der Schweizer Landwirtschaft bilden im weltweiten Vergleich ein Schlusslicht. Hauptsächlicher Treiber sind staatliche Fehlanreize durch hohe Subventionen und Preisstützungen. Weil der Bund in seinen Statistiken jeweils stark geschönte Zahlen zur wirtschaftlichen Lage der Landwirtschaft publiziert, wurde das eigentliche Ausmass des Desasters von der Politik und der Öffentlichkeit bisher kaum zur Kenntnis genommen.
Jahrzehntelange, im internationalen Vergleich extrem hohe Fehlanreize durch Subventionen haben die Schweizer Landwirtschaft in eine komplette Staats- und Industrieabhängigkeit getrieben.
2009 verdiente die Schweizer Landwirtschaft aus ihrer Produktion erstmals keinen Rappen mehr. Seither übersteigen die Kosten für Vorleistungen wie Futtermittel, Energie, Pestizide und Maschinen die Erlöse aus der Produktion. Dabei ist die von den Konsumenten getragene Preisstützung durch den Grenzschutz noch nicht einmal in die Rechnung miteinbezogen. Wird sie mit eingerechnet, schreiben die Schweizer Bauernbetriebe heute insgesamt rund 2 Milliarden Verluste, noch bevor sie sich einen Lohn ausbezahlt haben. Dies zeigen Analysen von Vision Landwirtschaft. Der Bund dagegen publiziert bis heute massiv geschönte Zahlen.
Die Subventionen halten also nicht einfach unrentable Strukturen am Leben, sondern fördern aktiv eine immer intensivere, enorm unwirtschaftliche Produktion, deren Kosten weit stärker steigen als die Ertragssteigerungen und die Erlöse aus den produzierten Produkten. Die Landwirtschaft ist zu einem wirtschaftlichen Durchlauferhitzer geworden. Ihre Einnahmen fliessen unter dem Strich vollständig an die vorgelagerten Branchen weiter. Agrarkonzerne steigern dabei ihren Umsatz Jahr für Jahr. Gleichzeitig entstehen durch den hohen Technik- und Hilfsstoffeinsatz massive Umweltschäden.
Die jetzige Politik weiterzuführen ist ökonomisch verantwortungslos. Die Zahlen und Fakten sind auf dem Tisch. Vision Landwirtschaft fordert für den Reformschritt der AP 2022+ grundlegende Korrekturen.
News und Beiträge zum Thema
Es braucht eine ganzheitliche Betrachtung des Agrar- und Ernährungssystems
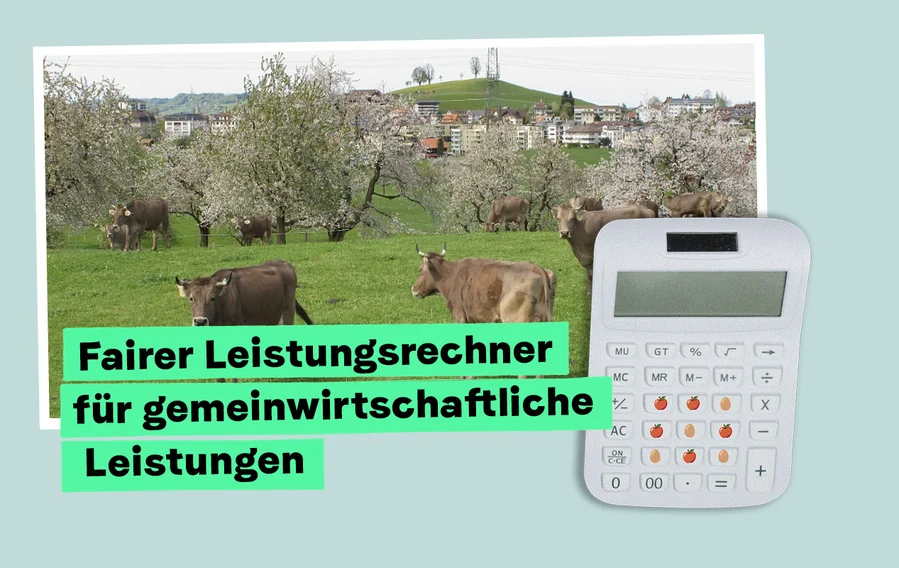
(VL) Hochstammbäume sind gut für die Umwelt und für die Menschen und daher werden sie auch mit Direktzahlungen unterstützt. Trotzdem sind die meisten Landwirt:innen froh, wenn sie möglichst wenig Ertrag haben. Denn das Obst ablesen und zu Most verarbeiten, lohnt sich in den meisten Fällen wirtschaftlich nicht. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wo wir mit der Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen stehen. Es braucht eine Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems hin zu einer Transformation des Ernährungssystems. Die AP 30+ bietet dazu Chancen.
Solarstrom auf dem Himbeerfeld: Wenn auf dem Acker nicht nur Beeren geerntet werden

(VL) Möchte die Schweiz bis 2050 beim Klimaschutz das Netto-Null Ziel erreichen, sind unter anderem innovative Ideen zur Stromproduktion gefragt. Welchen Beitrag die Landwirtschaft zur Energiewende leisten könnte, zeigt der Besuch auf einem Himbeerfeld im Luzernischen.
Die Schweizer Landwirtschaft kann und soll nicht wettbewerbsfähig sein!

Die Hochschule St. Gallen (HSG) hat den Grenzschutz für Gemüse und Obst untersucht. Gemäss der Studie werden einkommensschwache Haushalte durch die für Schweizer Gemüse verlangten Verkaufspreise zu stark belastet. Die Schweizer Landwirtschaft sei nicht wettbewerbsfähig, kritisieren die Forscher.
Sendung 10 vor 10 auf SRF, wo die Studie vorgestellt wird
Universität St. Gallen, Discussion Paper - Agricultural Protectionism
Unser Ernährungssystem – global und hochkomplex, aber es geht auch anders

Tag für Tag werden die Lebensmittelregale gefüllt und Restaurants und Kantinen beliefert. Tausende Produkte sind jederzeit verfügbar. Hinter dem Warenangebot steckt ein hochkomplexes System. Mit hohem logistischem Aufwand sorgen Landwirtschaft, Industrie und Handel dafür, dass die Produkte zur rechten Zeit am rechten Ort sind. Doch nur zu einem kleinen Teil landen Lebensmittel direkt aus der Region auf unseren Tellern. Denn die Landwirt:innen aus der Region produzieren überwiegend für den Grosshandel und dadurch legen die Lebensmittel hunderte von Kilometern zurück. Wenn zum Beispiel ein Zürcher Obstproduzent seine Äpfel an die Migros liefert, muss er diese nach Gossau im Kanton St. Gallen fahren und die Migros liefert diese dann an ihre Märkte in der Stadt Zürich. Das sind dann hin und zurück 150 km. Dieses System hat sich über Jahre entwickelt. Doch je komplexer ein System, desto mehr Energie wird benötigt und es wird anfälliger für Störungen aller Art.
Vegane Landwirtschaft – ein nachhaltiger Trend?

Radio SRF sucht im Rahmen eines Beitrages nach Antworten zu einer veganen Landwirtschaft und wie ökologisch diese wäre, wenn alle Schweizer Bauern aus der Fleischproduktion aussteigen würden. Die Sendung zeigt zudem auf, worauf Vision Landwirtschaft immer wieder hinweist: Die Tierbestände müssen deutlich reduziert werden und die staatliche Produktionslenkung setzt falsche Anreize. "Zur Sprache kommt auch eine Studie von Vision Landwirtschaft (15:20)." Das Problem ist auch nicht der Konsument, wie immer wieder behauptet wird, sondern das agrarpolitisches System, das die Preise zugunsten eines nicht nachhaltigen Konsums verzerrt und damit nachhaltiges Konsumverhalten systematisch behindert.
Diskussionspapier «Kostenwahrheit in Landwirtschaft und Ernährung»

Wie Vision Landwirtschaft vor einem halben Jahr in einer Studie aufgezeigt hat, ist die Schweizer Landwirtschaft und Ernährung weit entfernt von «Kostenwahrheit». Mit Blick auf Umweltrecht und Klimaziele wird das immer mehr zum Problem. Vision Landwirtschaft zeigt deshalb in einem neuen Papier auf, wie der Weg zu einer nachhaltigen Land- und Ernährungswirtschaft im Sinne der offiziellen Klimaziele und weiterer Ziele des Bundes aussehen könnte. Der Umbau der Subventionen im Sinne des Verursacherprinzips und der Kostenwahrheit spielt dabei eine tragende Rolle.
DOKUMENTE HERUNTERLADEN
