Versorgungssicherheit durch die überintensive Produktion in Bedrängnis
Versorgungssicherheit ist die Fähigkeit, im Krisenfall die Bevölkerung möglichst weitgehend aus den eigenen Ressourcen ernähren zu können. Das wichtigste Ziel der Versorgungssicherheit ist die Erhaltung der Produktionsgrundlagen, vor allem der Bodenfruchtbarkeit, funktionsfähiger landwirtschaftlicher Strukturen und der Ökosystemfunktionen. Die Versorgungssicherheitsbeiträge, der grösste Posten der Direktzahlungen, bewirken allerdings genau das Gegenteil. Sie fördern eine überintensive Produktion auf Kosten der Produktionsgrundlagen.
Unter dem Deckmantel der «Versorgungssicherheit» sind der Grossteil der Landwirtschaftssubventionen heute darauf ausgerichtet, die landwirtschaftliche Produktion weiter anzuheizen. Mit Erfolg: Noch nie wurde in der Schweiz so viel produziert wie heute, jedes Jahr ein bisschen mehr, obwohl laufend weniger Land bewirtschaftet wird. Doch die erreichte Produktionsintensität geht längst zulasten der Natur und damit der Produktionsgrundlagen der Landwirtschaft selber. Bodenfruchtbarkeit, Ökosystemfunktionen und Biodiversität geht es so schlecht wie noch nie. Die Produktionszunahme beeinträchtigt so zunehmend die Versorgungssicherheit.
Die Realisierung einer Agrarpolitik, die tatsächlich auf Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, gehört zu einem Kernanliegen von Vision Landwirtschaft. Dazu hat die Denkwerkstatt verschiedene Studien erstellt und konkrete Forderungen hergeleitet. An vorderster Stelle steht die Streichung der Versorgungssicherheitsbeiträge – mit über 1 Milliarde Franken jährlich der grösste und zugleich schädlichste Direktzahlungsposten. Bezeichnenderweise wurden diese Beitrage bisher vom Bund nie in ihrer Wirkung evaluiert. Ein parlamentarischer Vorstoss, der dies verlangte, wurde von einem Vertreter des Bauernverbandes erfolgreich blockiert. «So funktioniert die agrarpolitische Bananenrepublik Schweiz» titelte damals Vision Landwirtschaft.
News und Beiträge zum Thema
Mehr Schweizer Hülsenfrüchte auf den Teller

Dass dreimal mehr Hülsenfrüchte gegessen werden, das ist das Ziel des neuen Vereins «Schweizer Hülsenfrüchte». Vertreten sind darin Produzentenorganisationen, Verarbeiter und Handel. Mit verschiedenen Aktionen will der Verein vermitteln, dass Bohnen, Erbsen und Linsen cool sind und so das Ziel erreichen.
Schweizer Biozucker ist Mangelware

Wie ein Bericht des News-Magazin «10 vor 10» von SRF aufzeigt ,ist Schweizer Biozucker Mangelware. Bio Suisse will das nun ändern, aber auch Biozucker ist ungesund.
Die Umstellung von konventionellem Zuckeranbau auf Bio ist zwar gut für die Umwelt, weil so weniger Pestizide in die Umwelt kommen. Pestizide schädigen nachweislich die natürlichen Ressourcen sowie die menschliche Gesundheit. Wenn mehr Produzent:innen auf Bio umstellen, hilft das auch, dass vermehrt auf robuste Sorten gesetzt wird. Zuckerrübe ist eine schwierige Kultur und im konventionellen Anbau werden chemisch-synthetische Insektizide, Fungizide und Herbizide angewendet, welche unsere Biodiversität und unsere Gesundheit schädigen.
Lokale und globale Transformation des Ernährungssystems: Das Klima ist eine von vielen Herausforderungen.

Das Ernährungssystem besteht aus vielen zusammenhängenden ökologischen, sozialen und ökonomischen Komponenten. Weniger tierische Proteine, weniger Food Waste und eine auf agrarökologische Prinzipien beruhende Produktion: Das könnte die menschliche Gesundheit stärken und das Klima schonen. Im neusten ProClim Flash nimmt Bernhard Lehmann Stellung zur lokalen und globalen Transformation des Ernährungssystems.
Unser Ernährungssystem – global und hochkomplex, aber es geht auch anders

Tag für Tag werden die Lebensmittelregale gefüllt und Restaurants und Kantinen beliefert. Tausende Produkte sind jederzeit verfügbar. Hinter dem Warenangebot steckt ein hochkomplexes System. Mit hohem logistischem Aufwand sorgen Landwirtschaft, Industrie und Handel dafür, dass die Produkte zur rechten Zeit am rechten Ort sind. Doch nur zu einem kleinen Teil landen Lebensmittel direkt aus der Region auf unseren Tellern. Denn die Landwirt:innen aus der Region produzieren überwiegend für den Grosshandel und dadurch legen die Lebensmittel hunderte von Kilometern zurück. Wenn zum Beispiel ein Zürcher Obstproduzent seine Äpfel an die Migros liefert, muss er diese nach Gossau im Kanton St. Gallen fahren und die Migros liefert diese dann an ihre Märkte in der Stadt Zürich. Das sind dann hin und zurück 150 km. Dieses System hat sich über Jahre entwickelt. Doch je komplexer ein System, desto mehr Energie wird benötigt und es wird anfälliger für Störungen aller Art.
Wie ernährt man 10 Millionen Menschen?

Die Überlegungen der NZZ funktionieren sehr gut bei pflanzlichen Produkten jedoch viel weniger bei tierischen Produkten. Denn die grossen Belastungen der Produktion von tierischen Produkten entstehen durch die hohe Stickstoffverschmutzung (diese ist in Deutschland und Österreich ähnlich wie in der Schweiz) und einer Belastung der Biodiversität. Auch die hohen Treibhausgasemissionen welche durch die Tierhaltung verursacht werden sind im Ausland ähnlich hoch wie in der Schweiz und oftmals bei Bio-Produktion nicht wirklich geringer als bei konventioneller Produktion.
Ernährungssystemgipfel – Wissenschaft und Bürger:innen sind sich einig
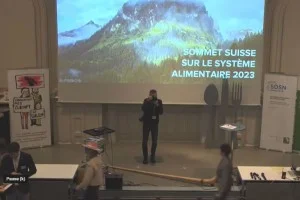
Am Ernährungssystemgipfel vom 2.2.2023 wurden neben den Empfehlungen des Bürger:innenrates auch der Leitfaden des wissenschaftlichen Gremiums Ernährungszukunft Schweiz an Bundesrat Parmelin und einige Nationalrätinnen und Nationalräte übergeben. Das Votum der Bürger:innen aus dem Bürger:innenrat ist klar: Wir müssen jetzt handeln.
Kommentar und Einordnung zu den Empfehlungen des Bürger:innenrats für Ernährungspolitik

Vision Landwirtschaft ist, zusammen mit vielen anderen, Partnerorganisation des Projektes Ernährungszukunft. Mit grossem Interesse haben wir die laufende Berichterstattung aus dem Projekt und jetzt auch die Publikation der Empfehlungen mitverfolgt. Die ganze Organisation mit den Lernausflügen und Austauschtreffen, aber auch wie das wissenschaftliche Gremium aufgebaut wurde, ist sehr überzeugend. Die Bürger:innen konnten sich sehr gut und breit informieren und daraus folgt nun auch die hohe Qualität der Empfehlungen. So entstand ein umfangreiches Dossier mit 53 Zielen, dazu 137 Empfehlungen, von denen in der finalen Abstimmung 126 angenommen worden sind.
Ernährungszukunft: Bürger:innenrat

Das Projekt Bürger:innenrat für Ernährungspolitik wurde lanciert und Vision Landwirtschaft ist als Partnerorganisation dabei.
Mit dem Bürger:innenrat (BEP) wird ein Dialoginstrument geschaffen, das Stadt und Land an einen Tisch bringt. Zusammen sollen alte Gräben geschlossen und gemeinsame Lösungen für nachhaltige Ernährungssysteme aufgezeigt werden. Beim BEP kommen 100 zufällig ausgeloste, in der Schweiz wohnhafte Menschen zusammen, um gemeinsame Massnahmeempfehlungen für eine nachhaltige Ernährungspolitik der Schweiz zu erarbeiten.
Landwirtschaftliche Bauten fressen immer mehr Kulturland

Während der Verlust an Kulturland durch Siedlung und Verkehrsinfrastruktur ausserhalb der Bauzone abnimmt und die Bevölkerung in dieser Zone laufend zurückgeht, wächst der Verlust an Landwirtschaftsland durch landwirtschaftliche Bauten weiter an. In den 1980er Jahren gingen in der Schweiz pro Jahr noch rund 40 Hektaren Kulturland durch die Landwirtschaft selber verloren. Heute sind es jährlich bereits fast 50 Hektaren. Dies, obwohl es immer weniger Höfe gibt. Gemäss dem Bundesamt für Raumentwicklung belegen diese Zahlen einen dringenden Handlungsbedarf. Der Bauernverband wehrt sich jedoch gegen ein griffigeres Raumplanungsgesetz, während er sich bei anderer Gelegenheit die Ernährungssicherheit gerne auf die Fahne schreibt.
Ohne Pestizide Europa ernähren

Bei einer Ernährung mit mehr Getreide, Obst und Gemüse, Eiweisspflanzen und dafür weniger Fleisch, Eier, Fisch und Milchprodukten wäre Europa im Jahr 2050 in der Lage, alle seine EinwohnerInnen aus dem eigenen Boden zu ernähren. Und dies durch eine nachhaltige, ökologische und klimafreundliche Landwirtschaft, die ohne Pestizide auskommt. Dies sind die Ergebnisse einer Studie des französischen «Instituts für Nachhaltige Entwicklung und Internationale Beziehungen» (IDDRI).
