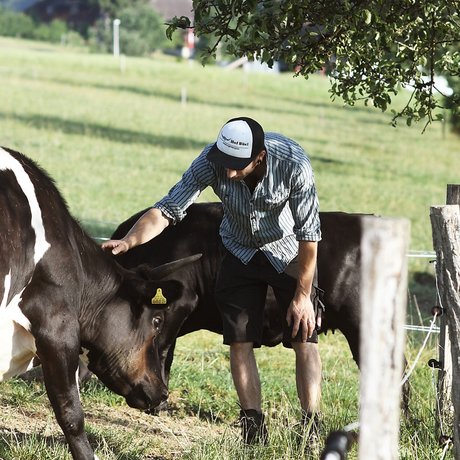Die Schweiz ist ein Grasland, prädestiniert für eine ressourcenschonende, tiergerechte Milch- und Fleischproduktion
Stattdessen setzt die Schweizer Milch- und Fleischproduktion immer mehr auf eine ineffiziente und teure Hochleistungsstrategie, die nur mit grossen Mengen an importierten Futtermitteln, mit viel Technik und Medikamenten funktioniert. Überproduktion und Umweltschäden sind die Folgen. Die Entwicklung wird von der Politik mit vielfältigen Fehlanreizen befördert. Für die Umwelt, das Tierwohl und das bäuerliche Einkommen eine fatale Sackgasse.
Die Schweiz hätte einzigartige Bedingungen für eine nachhaltige, graslandbasierte Produktion. Eine Tierhaltung, die sich auf die eigene Futterbasis und auf eine weitgehende Weidehaltung besinnt, hätte viele Probleme, in die sich die Landwirtschaft in den letzten Jahren hineinmanövriert hat, gar nie verursacht. Die Tiergesundheit wäre besser, der Antibiotikaverbrauch geringer, die Milch nachweislich gesünder, die enormen Umweltbelastungen der heute stark überhöhten Tierbestände ginge zurück, die zu hohen Kosten würden gesenkt und der Milchmarkt von seinen futterimportbedingten Milchüberschüssen entlastet, was wieder höhere Produzentenpreise für Milch ermöglichen würde.
Mit Studien, Vorzeigebetrieben und einer aktiven Medien- und Politikarbeit hat Vision Landwirtschaft wiederholt aufgezeigt, dass es funktionierende und naheliegende Alternativen zu den heutigen Fehlentwicklungen gibt.
Nicht zuletzt geht es um das Einkommen der Bauernfamilien. Unsere Studien zeigen: Dieses würde markant steigen, würde sich Politik und Landwirtschaft wieder auf die eigenen Ressourcen besinnen und auf eine weide- und graslandbasierte Produktion mit tiergerechten Leistungen statt Höchstleistungen setzen.
News und Beiträge zum Thema
Zwischen Wachstum und Schuldenfalle – wohin steuert die Schweizer Landwirtschaft?

Viele Schweizer Bauernbetriebe stehen unter Druck: Hohe Investitionskosten, steigende Schulden und stagnierende Erlöse belasten Einkommen und Familienleben. Vision Landwirtschaft fordert deshalb realistische Kreditprüfungen, faire Bewertung der Familienarbeit und Fördermodelle, die wirklich tragfähig sind – damit Expansion nicht zur Schuldenfalle wird.
Internationale Verflechtung der Schweizer Landwirtschaft und Gegenmodell Sennerei Splügen

Die Schweizer Landwirtschaft steckt in einem Spannungsfeld: Einerseits hohe Exportabhängigkeit, Preisdruck durch internationale Konkurrenz und Marktmacht im Detailhandel. Andererseits zeigen Modelle wie die Sennerei Splügen, dass es auch anders geht: bäuerlich getragen, regional verankert, weitgehend unabhängig von globalen Krisen und orientiert an Qualität statt an Masse.
Der Einfluss der Gemeinschaft aufs Fleischessen

Weihnachten naht und emotionsvolles, ausgeklügeltes Marketing läutet den jährlichen Einkaufsrausch ein. Auch die Planung rund um weihnachtliche Festessen mit Familie und Freunden steht an. Traditionelles Schüfeli, Fondue Chinoise oder doch Filet im Teig? Zur Vorspeise Lachs, oder geräucherte Forelle?
Vision Landwirtschaft möchte auf Ende des Jahres nochmals zum Nachdenken anregen. Und zwar wenden wir uns ein weiteres Mal dem Fleischkonsum zu. Der Weihnachtsschmaus ist ein wunderbares Beispiel, wie Essen eng mit unserer Kultur verwoben ist und die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Hier sind individuelle Verhaltensveränderungen besonders schwierig, da Essverhalten eingebettet ist in gemeinschaftliche Faktoren, wie Erwartungen, Anstand und Verpflichtungen. Die Reduktion des individuellen Fleischkonsums ist jedoch nötig, um die Klimaziele zu erreichen. Der folgende Newsletter nähert sich dem Thema ein weiteres Mal sozialtheoretisch und zeigt die Bedeutung des Fleischkonsums auf gemeinschaftlicher Ebene auf.
Auswirkungen einer standortangepassten Milch- und Rindfleischproduktion

Tierische Nahrungsmittel sind ein wichtiger Bestandteil unserer Ernährung. Sie verursachen aber gegenwärtig fast die Hälfte des ernährungsbedingten Klimafussabdrucks der Schweiz und sollten zu Gunsten einer pflanzenbasierten Ernährungsweise reduziert werden. Eine standortangepasste Milch- und Rindfleischproduktion würde die Regenerationsfähigkeit der im Inland verfügbaren Ressourcen erhalten und den Selbstversorgungsgrad erhöhen.
Im neusten ProClim Flash zeigt der Forscher Matthias Meier auf, dass eine Standort angepasste Produktion mit Tieren langfristig die Regenerationsfähigeit der Ökosysteme erhalten kann. Sein Fazit im Fachartikel: Mit einer standortangepassten Milch- und Rindfleischproduktion reduzieren sich die Klimagasemissionen aus der Schweizer Landwirtschaft durch den geringeren Rinderbestand insbesondere dank der dauerhaften Reduktion der Methanemissionen. Ein reduzierter Rinderbestand und ein tieferes Produktionsniveau haben auch Vorteile für die Biodiversität, da dadurch die Nährstoffverluste und insbesondere die Überdüngung empfindlicher Ökosysteme über Ammoniak abnehmen. Damit die Schweizer Landwirtschaft aber standortangepasst und klimafreundlich produzieren kann, ist die Umstellung hin zu pflanzenbetonten flexitarischen Ernährungsmustern in der Bevölkerung unumgänglich. Die heute die Fleischnachfrage dominierende Schweine- und Geflügelproduktion ergänzt in diesem Setting die Proteinversorgung sinnvoll – unter der Voraussetzung, dass sie sich ausschliesslich auf für die menschliche Ernährung nicht mehr direkt verwertbare Nebenströme der Lebensmittelwirtschaft stützt. Als Nebeneffekt erhöht sich der Selbstversorgungsgrad der Schweiz substanziell, weil der Bedarf an tierischem Protein aus einer graslandbasierten Milch- und Rindfleischproduktion gedeckt werden kann und Futtermittelimporte hinfällig werden.
Neue Ideen für eine klimafreundliche Milchwirtschaft

Wie kommen wir zu einer klimafreundlichen Landwirtschaft? Dazu durfte Vision Landwirtschaft im SRF «Trend» eine Einschätzung geben.
Das Projekt KlimaStaR-Milch zeigt auf, es gibt einen grossen Handlungsbedarf in der Milchwirtschaft. Wir brauchen für eine zukunftsfähige Milchwirtschaft langlebige Kuhtypen, die mit wenig bis keinem Kraftfutter auskommen, dafür aber das im Grasland Schweiz natürlicherweise wachsende Raufutter verwerten können. Die Bedingungen in der Agrar- und Ernährungspolitik müssen dazu führen, dass sich die nachhaltige Milchwirtschaft auch wirtschaftlich lohnt. Dazu braucht es eine Abkehr vom einseitigen Fokus auf eine hohe Milchleistung. Jeder Milchbetrieb produziert automatisch auch Fleisch, denn ohne jedes Jahr ein Kalb zu gebären, gibt eine Kuh keine Milch. Wenn das Gesamtsystem (Koppelprodukte) optimiert wird, ist das am besten fürs Klima und auch fürs Tierwohl.
Im aktuellen System profitieren vor allem die Konzerne in der vor- und nachgelagerten Industrie. Der Druck lastet momentan stark auf den einzelnen Betrieben und auf der Umwelt. Die hohen Futtermittelkosten belasten die Betriebe. Die Rahmenbedingen haben bisher alles auf die Hochleistungsstrategie ausgerichtet. Diese politischen Rahmenbedingungen müssen sich ebenfalls verändern für eine klimafreundliche Milchwirtschaft, die auch den Produzent:innen ein Einkommen generiert!
Vegane Landwirtschaft – ein nachhaltiger Trend?

Radio SRF sucht im Rahmen eines Beitrages nach Antworten zu einer veganen Landwirtschaft und wie ökologisch diese wäre, wenn alle Schweizer Bauern aus der Fleischproduktion aussteigen würden. Die Sendung zeigt zudem auf, worauf Vision Landwirtschaft immer wieder hinweist: Die Tierbestände müssen deutlich reduziert werden und die staatliche Produktionslenkung setzt falsche Anreize. "Zur Sprache kommt auch eine Studie von Vision Landwirtschaft (15:20)." Das Problem ist auch nicht der Konsument, wie immer wieder behauptet wird, sondern das agrarpolitisches System, das die Preise zugunsten eines nicht nachhaltigen Konsums verzerrt und damit nachhaltiges Konsumverhalten systematisch behindert.
Zuviel Stickstoff in der Luft: das macht unsere Wälder krank

Das Bundesamt für Umwelt weist erneut auf die Belastung der Wälder durch übermässigen Stickstoff aus der Luft hin und listet Massnahmen auf, wie sie zu reduzieren sind.
Zwei Drittel der stickstoffhaltigen Luftschadstoffe stammen aus der Landwirtschaft. Deshalb müssen dringend die Massnahmen für zur Reduktion der Ammoniak- und Stickoxidemissionen konsequent umgesetzt werden.
Beschwerde gegen Proviande teilweise gutgeheissen
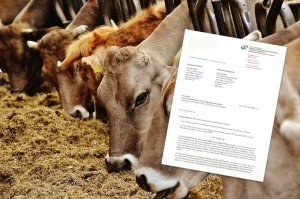
Das Selbstregulierungsorgan der Kommunikationsbranche, die «Schweizerische Lauterkeitskommission» (SLK) hat die Beschwerde (234/21) von Vision Landwirtschaft in zwei von vier Punkten gutgeheissen. Sie Beschwerdegegnerin ist angehalten, zwei Aussagen auf ihrer Webseite zu korrigieren.
Im wichtigsten Punkt der Beschwerde bleibt die SLK aber bei ihrer gewohnten Praxis: Der gezielte Einsatz von Halo- oder Heiligenschein-Effekten wird gutgeheissen. Man darf in der Werbung mit beliebigen - auch untypischen - Vorzeigebetrieben oder Vorzeigeprodukten ganze Produktpaletten wie «Schweizer Fleisch» bewerben. Die SLK verweist in diesem Fall auf einen früheren Entscheid (123/20), in dem sie schrieb: «Dem Durchschnittskonsumenten dürfte bewusst sein, dass auch in der Schweiz unterschiedliche Formen der Tierhaltung bestehen.» Das reicht für die SLK: Es liegt keine Irreführung vor.
Eine Begründung dafür, dass keine Irreführung vorliegt, hält die SLK nicht für nötig. Sie bezieht sich weder auf (in der Schweiz fehlende) frühere Gerichtsentscheide, noch auf empirische Studien. Dass die SLK keine fallbezogenen Konsumentenbefragungen durchführen kann, wie sie dem Infosperber (im Zusammenhang mit der Stellungnahme zur Beschwerde von Pro Natura über die Werbung von Swissmilk) antwortete, ist nachvollziehbar. Problemlos möglich wäre aber ein Bezug auf bestehende empirische Studien zu vergleichbaren Fragen.
Mit anderen Worten: Die SLK macht es sich zu einfach. Wo es nicht um faktisch falsche Aussagen, sondern um potenzielle Irreführung ging, hat die «erste Kammer» in einem viermonatigen «Verfahren» den feuchten Finger in die Luft gehalten und festgestellt, dass es keine Irreführung war.
Um in dieser Frage weiterzukommen, braucht es jetzt politische Vorstösse oder gerichtliche Entscheide, die auch eine mediale Wirkung entfalten. Vision Landwirtschaft bleibt am Thema dran.
Greenwash in Lehrmitteln – Swissmilk stellt Milchproduktion geschönt dar

(VL) Swissmilk stellt den Schulen Lehrmaterialien über die Milch und die Milchproduktion zur Verfügung. An sich eine gute Sache, da die Organisation mit Fachleuten arbeiten kann. Unschön ist jedoch, dass ausschliesslich die positiven Seiten der Milchproduktion gezeigt werden, und die negativen Folgen vollständig ausgeblendet sind. Neben den Schulmaterialien werden auch sog. Lehrfilme für die Werbung eingesetzt, so der Kurzfilm «Die Schweizer Milch ein Klimakiller?» Die Kernbotschaft des Filmes ist: Milchkühe setzen bei der Verdauung Methan frei, dieses wird nach 10 Jahren zu CO2 umgewandelt und lässt unsere Wiesen grünen. Und am Schluss, wird der Kuh Lovely gedankt für «die Pflege der Wiesen».
DOKUMENTE HERUNTERLADEN
Greenwash bei Produzentenorganisationen
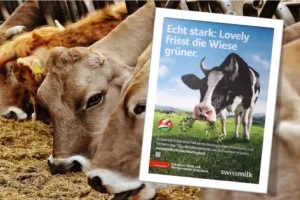
Nach Swissmilk fällt auch Proviande mit irreführender Werbung auf. Dieser Newsletter beleuchtet die rechtliche Situation, die Beschwerdemöglichkeit bei der Schweizerischen Lauterkeitskommission (SLK) und die neusten Entscheide der SLK im Zusammenhang mit Landwirtschaftsprodukten. Eine Beschwerde zur Proviande-Werbung soll zeigen, ob auf diesem Weg dem verbreiteten Greenwashing Grenzen gesetzt werden können. Als problematisch stellt sich heraus, dass die SLK für die Beurteilung Monate benötigt – länger als viele Werbekampagnen dauern.
DOKUMENTE HERUNTERLADEN
Kälbermast: Subventionen auf Kosten des Tierwohls

In der Kälbermast ist es Routine, Antibiotika zu verwenden. Die Mengen der eingesetzten Antibiotika je Kilogramm Fleisch stagnieren seit Jahren auf einem hohen Niveau. Wie häufig die Tiere Antibiotika verabreicht bekommen, hängt dabei unmittelbar mit der Haltungsart zusammen. Eine Studie der Universität Bern zeigt auf, dass mit einfachen Massnahmen die Landwirte den Antibiotikaeinsatz drastisch reduzieren können, ohne dass ihnen deswegen Wettbewerbsnachteile entstehen. Ein Saldo Artikel zeigt auf, warum die Bauern an der bestehenden Praxis festhalten.
DOKUMENTE HERUNTERLADEN
SCNAT: Dringender Handlungsbedarf bei den landwirtschaftlichen Stickstoff -und Phosphoremissionen

Die Stickstoff- und Phosphoreinträge der Landwirtschaft in die Umwelt sind viel zu hoch. "Sie schädigen Gesundheit, Biodiversität, Wälder und Gewässer in der Schweiz massiv", schreibt die Akademie der Naturwissenschaften SCNAT in einem neuen Factsheet und fordert das Parlament auf, jetzt endlich zu handeln.
Zum Hintergrund: Das Parlament behandelt derzeit eine parlamentarische Initiative, die genau dies vorhat und einen verbindlichen Nährstoff-Absenkpfad vorschlägt. Der Ständerat und die vorberatende Kommission des Nationalrates haben dieser Initiative allerdings die Zähne bis zur Unkenntlichkeit gezogen.
Federführend in diesem Trauerspiel war die CVP, die im Verbund mit der FDP vor den unglaublichsten Fehlinformationen im Parlament nicht zurückschreckte und damit offensichtlich eine Mehrheit herbeiführen konnte, um die parlamentarische Initiative ins Leere laufen zu lassen.
Dies kann der Nationalrat im Plenum am 2. Dezember noch korrigieren. Vision Landwirtschaft setzt sich an vorderster Front dafür ein, dass dieser Kraftakt gelingt.
Zum Factsheet der Schweizerischen Akademie der Naturwissenschaften SCNAT
In jedem Schweizer Poulet oder Schnitzel steckt zerstörter Amazonas-Regenwald

Rund ein Viertel des von Brasilien exportierten Soja stammt aus illegal abgeholzten Urwald. Das ist viel mehr als bisher angenommen, wie neue Analysen zeigen. Die Schweizer Landwirtschaft importierte 2019 für die hiesige Tierproduktion eine Viertel Million Tonnen Soja, davon die Hälfte aus Brasilien, die andere Hälfte aus Osteuropa.
Coronakrise: Weniger produzieren erhöht die Versorgungssicherheit

Viele versuchen derzeit, aus der Corona-Krise Profit zu schlagen. Auch der Bauernverband SBV nutzt die aktuelle Situation aus. Er will die Bemühungen des Bundes torpedieren, mit der Agrarpolitik 2022+ eine wenigstens etwas ökologischere Landwirtschaft zu fördern, wie die NZZ aufzeigt. Seine Argumentation: In Krisenzeiten bräuchten wir eine möglichst hohe Inlandproduktion, und dies selbst auf Kosten der Ökologie. Doch das Gegenteil ist richtig.
Wie die Agroindustrie zusammen mit den Agrarmedien den Bauern das Geld aus der Tasche zieht

Agrarmedien überquellen von Inseraten und eingelegten Reklameprospekten zu Produkten, welche ein Bauer "unbedingt haben muss". An der Schweizer Landwirtschaft lässt sich gutes Geld verdienen. Sie gibt Milliarden aus für Futtermittel, Futterzusätze, Pestizide, Dünger, neue Maschinen, neue Gebäude. An der Inserateflut verdienen auch die landwirtschaftlichen Medien kräftig mit. Um die Inserenten bei der Stange zu halten, werden regelmässig grundlegende journalistische Qualitätstandards missachtet. Versteckte Firmenwerbung im redaktionellen Teil ist gang und gäbe. Damit tragen die Bauernmedien eine wesentliche Mitverantwortung für die rekordteure, heute vollständig von Direktzahlungen abhängige Schweizer Landwirtschaft.
Zu hohe Stickstoffemissionen reduzieren Holzzuwachs

Zu hohe Stickstoffemissionen aus der Tierhaltung sind nicht nur Gift für die Biodiversität, sondern behindern auch den Holzzuwachs unserer Wälder. Dies zeigt eine neue Studie. Der kritische Wert liegt bei rund 30 kg Stickstoff pro Hektare und Jahr. Dieser Wert wird in der Schweiz vor allem in den Gegenden mit zu hohen Tierbeständen grossflächig deutlich überschritten.
Bisher galt für mitteleuropäische Wälder ein Stickstoffeintrag von über 10-20 kg/ha/Jahr als kritisch. Diese Werte würden nach wie vor gelten, schreiben die Studienautoren. Sie beziehen sich nicht auf das Baumwachstum, sondern auf die negativen Auswirkungen auf die Biodiversität, auf Flechten, Pilze und die Nitratauswaschung ins Grundwasser.
WWF-Benchmark Milchlabel: bestenfalls überzeugen Bio- und Wiesenmilch

Der WWF hat die wichtigsten Milchproduktionsstandards der Schweiz verglichen. Bewertet wurden Boden & Wasser (Ressourcenverwendung), Biodiversität, Klima & Energieeffizienz, Tierwohl und Produktionssysteme, Milchviehfütterung und Soziales. Die Ergebnisse sind ernüchternd: Der Umwelt- und Ressourcenschutz bleibt in fast allen Schweizer Milchlabels auf der Strecke. Nur gerade die Bio-Milch und die IP Suisse-Wiesenmilch (bei Erfüllung aller Zusatzleistungen) schneiden gut ab, am Schwanz liegt unter anderem das neu lancierte Label SwissMilk Green.
Brüssel zwingt die Deutsche Landwirtschaft zum Umdenken bei der Düngungspraxis

Nach jahrelangen Umweltversäumnissen in der Deutschen Landwirtschaft fordert die EU nun massive Verschärfungen in der Düngungspraxis, so unter anderem
- eine flächendeckende, schlagbezogene, elektronische Erfassung der Nährstoffströme,
- reduzierte Düngergaben für Hangflächen bereits ab 5% Neigung, und
- verlängerte Sperrfristen für das Ausbringen von Dünger in belasteten Gebieten.
Werden diese Forderungen nicht innerhalb kurzer Fristen erfüllt, drohen hohe Strafzahungen. Diese will die deutsche Politik unbedingt vermeiden. Politik und Verbände sind sich nun plötzlich über die notwendigen Verschärfungen einig.
Die Schweizer Landwirtschaft und Agrarpolitik bleiben vorläufig weit hinter den Forderungen der EU zurück. Druck macht hierzulande nicht Brüssel, sondern "das Volk". Mit einer Annahme der Trinkwasserinitiative müsste auch die Schweiz mit jahrzehntelangen Versäumnissen aufräumen und die gesetzeswidrig überhöhte Düngerbelastung von Gewässern, Böden und empfindlichen Ökosystemen deutlich senken.
Mehr zur Situation in Deutschland in agrarheute.
Schoggigesetz - ein Musterbeispiel für absurde Agrarsubventionen

In der Schweiz wird 20% mehr Milch produziert als der heimische Markt aufnehmen kann. Bis 2018 wurde die überschüssige Milch mittels Exportsubventionen ins Ausland abgesetzt. Rund 80 Millionen Franken Steuergelder setzte der Bund dafür jedes Jahr ein.
Da die Schweiz damit gegen die Regeln der WTO verstiess, wurde sie gezwungen, das Schoggigesetz 2018 aufzugeben. 2019 trat eine trickreiche Nachfolgeregelung in Kraft. Der Bund verbilligt nun weiterhin mit 80 Millionen Franken die Milchexporte - neu aber indirekt über ein privatrechtlich organisiertes Konstrukt. Wie die NZZ berichtet, geraten sich nun die bezuschussten Firmen und Produzenten in Bezug auf die Verteilung der Gelder in die Haare.