Die Berglandwirtschaft braucht gezieltere Unterstützung
Die finanzielle Unterstützung von Bauernbetrieben in Steillagen ist trotz deutlich schlechterer Einkommenssituation viel geringer als die Zahlungen an Höfe in Gunstlagen. Durch die Agrarreform von 2014 ist dieses Ungleichgewicht - massgeblich dank dem Engagement von Vision Landwirtschaft - etwas kleiner geworden, indem die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Berglandwirtschaft besser entschädigt werden. Die Nutzungsaufgabe in Erschwernislagen ist dadurch etwas zurückgegangen. Doch es braucht weitere Korrekturen.
Mit knapp einem Quadratmeter pro Sekunde geht in Erschwernislagen im Berggebiet fast ebenso viel Landwirtschaftsland durch Nutzungsaufgabe verloren wie in den Gunstlagen der Schweiz durch die rege Bautätigkeit. Zwar hat sich diese Entwicklung seit der Reform 2014 abgeschwächt. Aber vor allem in topographisch schwierigen Regionen sind viele Flächen auch heute noch kaum wirtschaftlich zu bewirtschaften und das Einkommen von Bergbetrieben ausserordentlich klein.
Auf der anderen Seite haben in den flacheren Lagen des Berggebietes die Direktzahlungen infolge von Fehlanreizen seit der Reform jedes gesunde Mass überschritten. Es braucht dringend einen Ausgleich: Weniger Zahlungen in Gunstlagen des Tal- und Berggebietes und höhere Zahlungen für Steillagen und für nachhaltige Bewirtschaftungsformen. Lösungen liegen längst auf dem Tisch. Mit dem nächsten Reformschritt der Agrarpolitik ab 2021 müssen sie endlich konsequent umgesetzt werden.
News und Beiträge zum Thema
Herbizide vergiften Alpweiden

Zusammen mit zwei Experten besuchte der "Beobachter" Schwyzer Alpen. Sie trafen auf vergiftete Farne, Steinhaufen, Brennnesseln. 30 verschiedene Herbizide werden eingesetzt, um unerwünschte Kräuter abzutöten. Dafür verantwortlich sei jahrzehntelange Misswirtschaft. Und höhere Direktzahlungen.
Betriebe in Erschwernislagen brauchen eine bessere Unterstützung durch die Agrarpolitik

Bereits heute gibt es Direktzahlungen, welche die erhöhten Erschwernisse im Berggebiet ausgleichen sollen. Ein kleiner Teil davon ist an die Hangneigung gebunden (die sog. „Hangbeiträge“), über drei Viertel bzw. 354 Millionen Franken pro Jahr dagegen hängen von der Anzahl gehaltener Tiere und der Höhenzone ab („TEP-Beiträge“): Je höher ein Betrieb liegt und je mehr Vieh er hält, desto mehr Erschwernisbeiträge erhält er. Doch die TEP-Beiträge haben zwei grosse Nachteile.
DOKUMENTE HERUNTERLADEN
Faktenblatt Nr. 3: Gezieltere Erschwernisbeiträge zugunsten einer flächendeckenden Bewirtschaftung

Landwirtschaftsbetriebe in Erschwernislagen brauchen eine bessere Unterstützung durch die Agrarpolitik
Bereits heute gibt es Direktzahlungen, welche die erhöhten Erschwernisse im Berggebiet ausgleichen sollen. Ein kleiner Teil davon ist an die Hangneigung gebunden (die sog. "Hangbeiträge"), über drei Viertel bzw. 354 Millionen Franken pro Jahr dagegen hängen von der Anzahl gehaltener Tiere und der Höhenzone ab ("TEP-Beiträge"): Je höher ein Betrieb liegt und je mehr Vieh er hält, desto mehr Erschwernisbeiträge erhält er. Das führt einerseits zu starken Fehlanreizen, zu viele Tiere zu halten. Und es ist ungerecht. Betriebe in besonderen Erschwernislagen erhalten dadurch nur einen Bruchteil der Direktzahlungen von Betrieben in Gunstlagen des Berggebietes. Das Faktenblatt Nr. 3 enthält dazu die überraschenden Fakten und macht konkrete Vorschläge, die in Form verschiedener Anträge bereits in den parlamentarischen Prozess zur Reform der Agrarpolitik eingeflossen sind.
DOKUMENTE HERUNTERLADEN
CultivAlpe - Landwirtschaftliche Flächenaufgabe und Wiedernutzung im Schweizer Berggebiet. Ursachen, Instrumente und Perspektiven

In den Grenzertragslagen des Schweizer Berggebietes geht mit knapp einem Quadratmeter pro Sekunde fast ebenso viel Landwirtschaftsland durch Nutzungsaufgabe verloren wie in den Gunstlagen der Schweiz durch die rege Bautätigkeit. Die Entwicklung beeinträchtigt die Biodiversität und die Qualität der Kulturlandschaft im Berggebiet und vermindert die Nahrungsmittelproduktion. Nicht zuletzt gehen der Berglandwirtschaft zunehmend Einkommensmöglichkeiten und Wertschöpfung verloren.
Die Forschungsarbeit, die vom Geschäftsführer von Vision Landwirtschaft geleitet wurde, fragt nach den Gründen und Motiven, die Bauern und Bäuerinnen, Älplerinnen und Älpler im Schweizer Berggebiet dazu veranlassen, Flächen weiter zu nutzen, aufzugeben, oder auch wieder in die Nutzung zu nehmen. Die Untersuchung basiert neben einer Literaturauswertung vor allem auf Befragungen von 40 Landwirtschaftsbetrieben in 6 Projektregionen und von 8 Projektinitiativen, die sich mit der Wiedernutzung von aufgegebenen Flächen befassen.
DOKUMENTE HERUNTERLADEN
Das Weissbuch zur Landwirtschaft
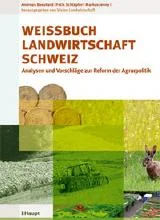
Das 2010 von Vison Landwirtschaft herausgegebene "Weissbuch Landwirtschaft Schweiz" legte einen entscheidenden Grundstein für die wieder in Gang gekommenen Reformbemühungen der Schweizer Landwirtschaftspolitik. Die erste Auflage des Buches war innert weniger Monate ausverkauft. Die zweite Auflage ist hier erhältlich.
Die Anfangs der 1990er Jahre auf Druck verschiedener Volksinitiativen eingeleitete Agrarreform kam während zwei Jahrzehnten kaum vom Fleck. Der Grossteil der damals eingeführten agrarpolitischen Instrumente wurden den damals gesetzten Zielen und dem neuen landwirtschaftlichen Verfassungsartikel von 1996 nicht gerecht. Öffentliche Mittel in Milliardenhöhe wurden nicht verfassungskonform eingesetzt und schadeten der Zukunftsfähigkeit, der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit der Schweizer Landwirtschaft in unverantwortlicher Weise.
DOKUMENTE HERUNTERLADEN
